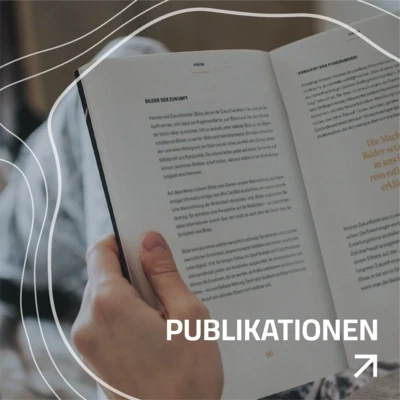Empfohlene Produkte
Limitierte Plätze!

Summer Conference Vienna 2024
Summer Conference Vienna 2024
Exklusiver Vorsprung: Ihre zertifizierte Weiterbildung zum Future Manager
1.350,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

Future Business Guide KI Empowerment (Digitalausgabe)
Future Business Guide KI Empowerment (Digitalausgabe)
Unternehmerische Handlungsfelder in der Ära generativer KI
99,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
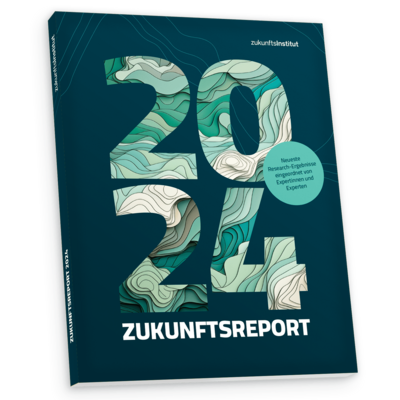
Zukunftsreport 2024
Zukunftsreport 2024
Ihr Ausblick mit neuesten Research-Ergebnissen, eingeordnet von Expertinnen und Experten
150,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand
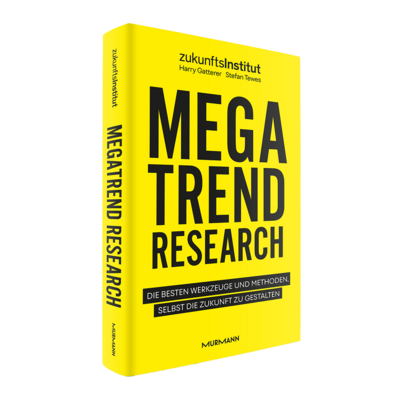
Megatrend Research
Megatrend Research
Megatrend Research präsentiert einen völlig neuen Ansatz der Trend- und Zukunftsforschung
24,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand

Retail Report
Retail Report
Redefine Retail – Wo Sie jetzt handeln müssen
175,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand
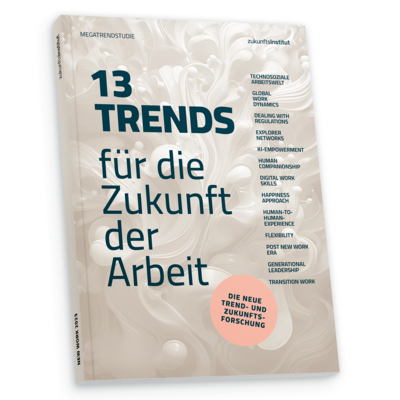
13 Trends für die Zukunft der Arbeit
13 Trends für die Zukunft der Arbeit
Was kommt nach New Work? – Erkennen Sie die Zusammenhänge der neuen Arbeitswelt.
150,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand
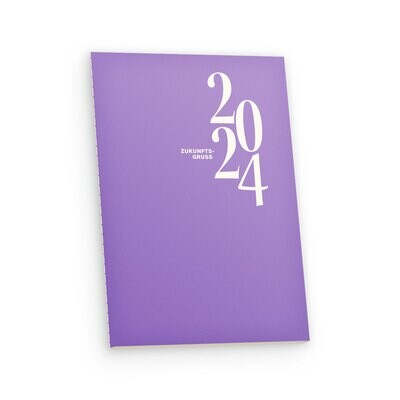
Zukunftsgruß 2024
Zukunftsgruß 2024
Das ideale Geschenk: 10 Zitate, 10 Texte, 10 Mal Umdenken, das uns positiv in die Zukunft blicken lässt.
12,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand
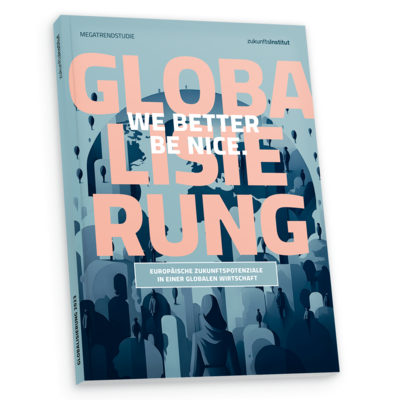
Megatrendstudie Globalisierung
Megatrendstudie Globalisierung
Europäische Zukunftspotenziale in einer globalen Wirtschaft
150,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand

Megatrend-Dokumentation
Megatrend-Dokumentation
Die Megatrend-Dokumentation bietet einen umfassenden Überblick über Veränderungen, die unsere Welt heute & morgen beeinflussen.
600,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand

Deine Zukunft!
Deine Zukunft!
„Deine Zukunft!“ gibt Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des Zukunftsinstituts.
30,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand

Food Report 2024
Food Report 2024
Verstehen Sie die wichtigsten Food-Trends und lernen Sie die Ernährungskonzepte der Zukunft kennen.
175,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand
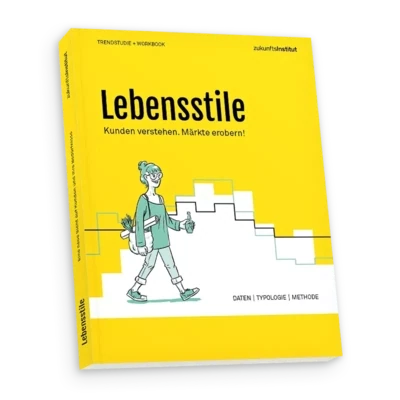
Lebensstile (Digitalausgabe)
Lebensstile (Digitalausgabe)
Die Lebensstile-Dokumentation ermöglicht es, Bedürfnisse der Kunden zu verstehen. Inklusive „Relations Mapping“-Tool!
380,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen

Workbook Vision
Workbook Vision
Das Praxisbuch für die Entwicklung Ihrer Unternehmensvision, basierend auf den Beratungsmethoden des Zukunftsinstituts.
140,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand
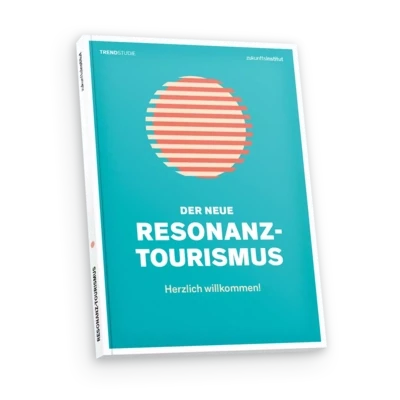
Der neue Resonanz-Tourismus
Der neue Resonanz-Tourismus
Die Trendstudie zeigt die Chancen eines an menschlichen Entwicklungsbedürfnissen Tourismus auf.
150,00 €
Preis inkl. USt., USt. für Veranstaltungen, USt. für Weiterbildungen
zzgl.
Versand